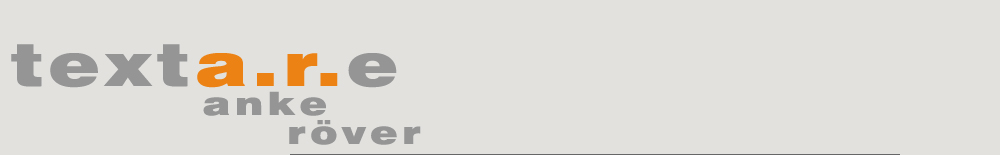Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, die beruflich häufiger mit dem vermeintlich notwendigen (weil politisch korrekten) Gendern konfrontiert werden − mich nervt es auf jeden Fall zusehends. Als (Nebenfach-)Linguistin ist mir seit Studienzeiten klar, dass Sprache unser Bewusstsein prägt. Als ich dann einen Arbeitsvertrag unterschreiben sollte, in dem mein Name stand, gefolgt von ‚im Folgenden der Volontär genannt‘, war ich durchaus empört und fand, da es ja nun um mich ging und ich eindeutig weiblich bin, der mich ausbildende Medienbetrieb auch nicht unbedingt als überaus konservativ galt, hätte die ‚Volontärin‘ dem Vertrag gut zu Gesicht gestanden. Mangelndes Selbstbewusstsein wurde von den männlichen Kollegen als Quelle meines (leisen) Protests ausgemacht. Ich dagegen wertete diese Aussage als Ausdruck von Ignoranz, denn für mich stand fest, dass diese sprachliche Verfehlung weder beruflichen Ehrgeiz noch Rollenverständnis meinerseits beeinträchtigen würde, sagte sie doch tatsächlich mehr mehr über die Verfasser als über mich aus.
Während meines Studiums hatte ich allerdings auch immer wenig Verständnis für die Leidenschaft, mit der studentische Gruppierungen sich der Debatte widmeten, ob der Plural für die eigene Spezies nun StudentInnen oder Studierende sein solle. Der Einfachheit halber entschied ich mich schon früh für das geschlechtsneutrale ‚Studierende‘, bei dem angeblich keine patriarchalischen Vorstellungen transportiert werden. Ich gebe aber zu, dass ich mich durch die Verwendung des Plurals ‚Studenten‘ weder diskiminiert noch der männlichen Übermacht unterworfen fühlte (zumindest solange ich als StudentIN gelten durfte, was ich prinzipiell für gegeben erachtete). Der Widerwillen gegen diese hitzigen Diskussionen ist geblieben, die gedankliche Auseinandersetzung und eigene Standortbestimmung hat gleichwohl stattgefunden − und das immer wieder mit teils wechselnden Ergebnissen. Sprachguru Bastian Sick hat meiner Meinung nach eine zu radikale Haltung zu dem Thema, den offenen Brief, den er gemeinsam mit österreichischen Wissenschaftlern (und natürlich Wissenschaftlerinnen ;-)) und vielen mehr unterzeichnet hat, halte ich keineswegs für den Maßstab der sprachlichen Bewertung, da zahlreiche Aspekte und nachgewiesene Mechanismen einfach ausgeblendet werden. Zum Beispiel der Einfluss der Sprache auf die Vorstellungswelt: Die Kölner FH ruft in diesem Zusammenhang auf ihrer Website zu einem einfachen kleinen Selbsttest auf. Wie reagiert der Leser auf die Aufforderung „Nennen Sie einen berühmten Schriftsteller!“? Natürlich fällt einem zuerst ein Mann ein. Wird man degegen gebeten, eine berühmte Schriftstellerin oder einen berühmten Schriftsteller zu nennen, wird der Ideenfluss nicht mehr nur auf männliche Autoren beschränkt. Dazu kommt, dass eine vollkommen genderfreie Sprache − sofern sie nicht wie Englisch per se geschlechtsneutral angelegt ist und kein grammatikalisches Geschlecht kennt − auch die Lebensrealität naturgemäß nicht korrekt abbilden kann. Darauf haben die österreichischen Juristinnen in einer Stellungnahme zu dem offenen Brief hingewiesen und außerdem noch einmal auf die bewusstseinsprägende Wirkung von Sprache hingewiesen. Ob aber durch den Verzicht auf gendergerechte Sprache tatsächlich tradierte (und inzwischen unerwünschte) Geschlechterrollen festgeschrieben werden, weil diese Verwendung die weibliche der männlichen Form unterwirft, das wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln. Gläserne Decken, die immer noch Frauen den Aufstieg in höchste Führungsebenen unmöglich machen, durchbricht man gewiss nicht, indem man das Binnen-I zur Norm macht. Gegen fundamentale Ungerechtigkeiten in der Bezahlung von weiblicher und männlicher Arbeit bleibt das Gendern wirkungslos und auch auf die Verteilung der Aufgaben und Rollen innerhalb von Familien hat es keinerlei nennenswerten Einfluss. Nein, man muss wahrlich nicht dem generischen Maskulinum das Wort reden, aber ihm eine solche Macht zuzugestehen, dass es gesellschaftliche Veränderung und das Ende der Diskrimierung verhindern könne, das muss tatsächlich auch nicht sein. Ich glaube dagegen fest daran, dass erst das (hoffentlich absehbare) Ende dieses Streits anzeigen wird, dass Gleichberechtigung allen nicht zu leugnenden geschlechtlichen Unterschieden zum Trotz endlich, endlich gesellschaftliche Realität ist.
Derweil nehme ich mir die Freiheit, hin und wieder nur von Schülerinnen zu reden, Krankenpfleger anzusprechen, über Gesellschafterinnen zu berichten und Zuhörer um Aufmerksamkeit zu bitten … Natürlich nur dann, wenn es der Lesbarkeit meiner Texte dient und sich außerdem keine geschlechtsneutralen Alternativen finden lassen oder aber jene schon im gleichen Atemzug genannt wurden. Es ist das Dogma, das es so schwierig macht, das geforderte bedingungslose Bekenntnis zu einer Seite und die drohende Verurteilung durch die andere. Zwei Eigenschaften wohnen der Sprache inne, nämlich einmal die Dynamik, die ihren Wandel ermöglicht und Veränderungen zulässt, andererseits aber auch die Regelhaftigkeit, die die Basis der allgemeinen Verständlichkeit ist. Political correctness hin oder her − in diesem Spannungsfeld ist mehr möglich als nur eine Variante.